Freitag, 1. Juni 2007
Ein Tag im November
cabman, 00:25h

So standen sie da, lauschten den Worten des Scheidungsrichters und ihre Blicke ruhten auf ihm gerade so wie damals, als in ähnlichem Gebäude ein anderer Beamter ihre Liebe staatlich besiegelte. Still nebeneinander doch diesmal ohne erkennbare Gefühlsregung, nahmen sie die Worte entgegen.
„Sind Sie nun willens und erklären Ihre Ehe als unheilbar zerrüttet und somit als gescheitert?“ fragte der Richter mit tonloser, nasaler Stimme. Seine Augen, hinter einer randlosen Brille klein und stechend, wanderten dabei zwischen den beiden hin und her.
Sie nickte leicht.
Er antwortet laut und deutlich: „Nein.“
Dem Richter zuckte kurzes Erstaunen ins Gesicht; sie drehte ruckartig den Kopf zu ihrem Nochmann, sah in fragend an.
„Nein“, wiederholte dieser sich. Und ohne ihr oder dem Beamten eine Chance des Fragens zu geben, fuhr er fort: „Es ist falsch, ja sogar lächerlich in diesem Zusammenhang von unheilbar zu reden, denn dies ist eine Frage von Krankheit. Welche Krankheit könnten wir wohl haben, die es zu heilen gelte? Ich sag es euch: Keine!“
Während er dies sagte, ging er zu einem der riesigen Fenster der Amtsstube. Er blickte hinaus in stahlgrauen Winterhimmel, sah auf die schneelose trübe Strassenszenerie vor dem Amtsgebäude. „Allein“, begann er leise. „Ja, allein sind wir wohl gewesen – oft - leider viel zu oft. Selbst wenn wir gemeinsam im Theater waren, war dies immer weniger eine gemeinsame Erfahrung. Jeder von uns glich mehr und mehr einem Trümmerstück, eine Beziehung wie eine rotte, baufällige Kriegsruine, abgelebt und nicht mehr zu retten, nur noch gehalten durch Moniereisen der ökonomische Abhängigkeit und einer gemeinsamen Wohnung. Das nenne ich aber nicht Krankheit. Krankheit kommt wann und wie sie es will, unbeeinflussbar.
Dem Verfall, der Alltagsverwitterung hätten wir jedoch vorbeugen können und nun ist es zu spät. Diese Ruine haben wir selbst hinbekommen -ganz allein- und weil es so ist, zeigt dies doch nur, dass wir es insgeheim wohl auch so wollten.“
Er blickt hinaus. Eine Krähe landete auf der Straßenlaterne etwas weiter unter ihm. Sie betrachtend, zeichneten seine Finger den Kitt des Fensters nach. Einfachverglasung, zugig und schlecht isolierend, dachte er.
„Ich glaube, ich verstehe was Sie sagen wollen.“ richtete der Richter das Wort an ihn. „Heißt dies nun, das Sie mit einer Änderung des Vokabulars…“ weiter kam er nicht. Er wurde schroff unterbrochen.
„Wissen Sie was ich glaube?“ fragte der Nochehemann, der sich dabei wieder ihr und dem Richter zuwandte. „Ich glaube, im Grunde ist es Ihnen völlig egal, was aus uns und unseren Vorstellung wird, oder? Haben Sie sich je gefragt, was aus alle den Worten, den Wünschen und Hoffnungen wird, die in einer solchen Situation sterben? Nie, stimmt`s?“
„Wissen Sie, ich denke es ist nur mein Job. Dieser Termin hier hat ausschließlich einen formalen Hintergrund. Es muss doch alles seine Richtigkeit haben. Denken Sie nur mal an die Steuer.“
„Ich weiß“, lenkte der Nochehemann ein. „Ich mach Ihnen auch keinen Vorwurf. Doch“, und während er dies sagte, zog er eine Pistole unter seinem Sakko hervor, „verzeihen Sie mir bitte, aber ich halte Sie für den Totengräber von Lebensentwürfen.“
„Oh Gott“, riefen Richter und Nochehefrau schutzsuchend aus.
„Mach doch kein Quatsch“, schrie sie fast hysterisch ihren Nochehemann an.
„Wir können darüber reden. Sei nicht unvernünftig!“ rief sie hinter dem Schreibtisch hervor.
Aber er hörte ihre Worte nur noch wie ein fernes Rauschen. Er drehte sich wieder zum Fenster, öffnete dieses und stieg aufs Fensterbrett.
„Wissen Sie, ich habe einen Entschluss gefasst.“
Kalte Winterluft durchströmte seine Lungen; die Krähe saß noch immer auf der Laterne und beäugte ihn nun.
„Diesmal werden Sie nichts zu Grabe tragen können. Gar nichts. Tut mir leid, dass Sie umsonst heute Morgen aufstanden, aber meine Träume gehören mir. Ich habe sie noch immer und auch wenn ich sie nicht leben kann, dann kann ich sie wenigstens mitnehmen, für immer behalten.“
Sorgfältig legte er die Pistole ab und sprang.
Die Krähe, in Fluchtreaktion, schwang sich mit wildem Flügelschlag davon. Höher und höher stieg die schwarze Silhouette vor grauem Novemberhimmel bis sie sich plötzlich aufzulösen schien…

... link (6 Kommentare) ... comment
Montag, 21. Mai 2007
This shit will fuck you up [Ein Versuch]
cabman, 00:31h

"Warum meinen Sie, ich hätte geweint?"
"Nun, Sie scheinen mir älter als Zwölf, ihr Whisky ist noch halbvoll und es hat auch nicht geregnet. Warum also, sollte Ihr Make-Up verlaufen sein?"
"Sie haben recht. Manchmal ist es einfach nur..."
"Ja. Ich weiß. Aber glauben Sie mir, die Zeit wird alle Wunden heilen."
"Ich würde Ihnen gern glauben."
"Was hält Sie davon ab?"
"Zu oft habe ich gehofft, zu oft wurde ich enttäuscht. Immer wenn die eine Wunde verheilte, schlugen Worte oder die Umstände eine andere."
"Das ist der Lauf der Dinge. Manche nennen es Leben."
"Wenn es das ist, ist es beschissen."
"Solche Worte aus Ihrem Mund?"
"Es wird ja nicht besser, wenn wir ihm Kosenamen geben, oder?"
"Jetzt haben Sie recht. Noch einen Drink?"
"Ja, bitte. Zwei Fragen hätte ich noch."
"Und die wären?
"Wo wohnen Sie und wie komme ich da am Schnellsten hin?"

"Oh Gott."
"Ich liege gleich neben dir."
"Ich weiß. Ich fühle mich ziemlich daneben. Haben wir gestern soviel getrunken?"
"Nicht wir, du. Du ganz allein."
"Oh fuck. Ich kann mich nicht erinnern. Muß ich mich für etwas schämen oder entschuldigen?"
"Nein."
"Ehrlich? Ich meine, ähm... wie lief es denn so, zwischen uns, hier im Bett."
"Gut."
"Wie? Was heißt gut?"
"Ich wollte schlafen und du tatest es schon, als ich ins Bett kam."
"Da ist nichts gelaufen?"
"Nee."
"Gott sei Dank."
"Wieso? So häßlich bin wohl nicht?"
"Nein. Im Gegenteil. Du bist wunderschön. Ich glaube ich habe mich verliebt. Deswegen wäre es auch eine Schande, hätten wir alles mit einem schlechten One-Night-Stand versaut."
"Du hast dich in mich verliebt?"
"Ja. Ich dachte du wüßtest es bereits."
"Wie könnte ich. Aber ich freue mich sehr darüber."
"Wollen wir Frühstücken gehen?"
"Oh ja, bitte. Laß uns romantisch Frühstücken gehen."

"Ja hallo?"
"Hier spricht Wachtmeister Slobowitsch. Mit wem sprech ich bitte?"
"Mit Frau Sibbel. Worum geht es denn?"
"Frau Sibbel, ich muß Ihnen leider mitteielen, dass es einen Unfall gegeben hat. Kennen Sie einen Herrn Sawatzki?"
"Oh nein!!!"
"Bitte?"
"Doch ja. Ich kenne ihn. Wir sind seid Kurzem liiert. Was ist denn passiert? Wie geht es ihm?"
"Frau Sibbel, ich muß Sie bitten, ins Krankenhaus zu kommen."
"Ja gut. In welchem liegt er? Soll ich ihm etwas mitbringen?"
"Frau Sibbel, Sie müssen jetzt sehr stark sein, denn..."
"Oh Gott, sag das dies nicht wahr ist!! Sag, es ist eine Lüge! Bitte nicht, nicht er, nicht jetzt!"
"Frau Sibbel, es tut mir sehr leid."

"Und Sie sind wer, wenn ich fragen darf?"
"Ich bin eine Freundin des Verstorbenen."
"Ach Sie sind die Ellen?"
"Ja, bin ich. Wieso kennen Sie meinen Namen?"
"Ach wissen Sie, ich bin ja jahrelang Tobis Friseuse gewesen. In letzter Zeit war er so fröhlich, gelacht hat er und war zu Scherzen aufgelegt. Sie haben ihm sehr gut getan. Vielleicht wissen Sie es gar nicht, aber er hatte ein schlimme Zeit hinter sich."
"Nein das wusste ich nicht."
"Na, jedenfalls ist es eine Schande, dass der Herr ihn ausgerechnet jetzt zu sich geholt hat. Wo doch alles so gut für ihn lief."
"Ja, stimmt. Wir hatten Pläne."
"Eine Tragödie ist es. Ach, übrigens, wenn Sie einen guten Frisuer brauchen, melden Sie sich bei mir. Werden Sie das tun?"
"Bestimmt, irgendwann."
"Ja, so etwas braucht Zeit, das Leben braucht immer seine Zeit und manchmal sind wir einfach nur zur falschen Zeit am Leben."

"Hi. Das ist der Anrufbeantworter von Ellen. Ich bin nicht da und komme auch nicht wieder. Ich habe mir ein Fleckchen Erde gesucht, wo mein Leben und meine Wünsche im Gleichtakt sind, zur richtigen Zeit. Adieu!"

... link (4 Kommentare) ... comment
Samstag, 21. April 2007
Das Erscheinen der Messia S. oder Die Reise des Kühlschrankes geht weiter
cabman, 21:02h
Darum geht es.
Herzlichen Dank auch an Herrn Gorilla mit der Bitte um Entschuldigung für die Verspätung;-)
Anderen Orts, zur gleichen Zeit, während stille Apathie Einzug hielt und die versammelten Kühlschränke ihren Gedanken nachhingen, weit draußen vor der Küste Afrikas, wo die Sonne hoch stand und wenig glückvolle Emigrierversuche am Meeresgrund zu Fischfutter mutierten, also eben da, auf einem Schiff, dass da hieß „Sonne des Ostens“, welches aus dem Westen kam, da stand sie, die Messia S..
Sie war jung und schön, eine preisprämierte Augenweide, Tochter deutsche Ingenieurskunst, grazil, elegant, gut gebaut, verlässlich und funktional.
Eine Sünde sei es, sagten die Matrosen an Bord, die ihr oft die Flanken rieben. Nur zu gern hätte sie sich ihnen dann hingegeben, hätte sich ihnen bereitwillig geöffnet und sie in höchste Höhen bugsiert. Doch vorbei war die Zeit dieses tollen Treibens, bevor sie wirklich anfing.
Es war nun schon eine lange Reise und sie hatte sich zwischenzeitlich mit einem Toaster angefreundet. Dieser hieß P-Trus 1000 und war einmal ein recht flottes Modell, doch seit die Schäflein, die ihm anvertraut wurden, allzu oft ihre schwarze Gesinnung auch durch ihr Äußeres Ausdruck verliehen und in Ausnahmefällen auch Brände stiften, war seine Zeit abgelaufen. Er hatte ja gesagt, er fühle sich immer öfter ausgebrannt, etwas überspannt, könne nicht mehr garantieren, jedem die gleiche Sorgfalt und Hingabe schenken zu können, wie es seine Pflicht gewesen wäre. Doch sie hörten nicht auf ihn, sondern schickten ihn in eine Therapie, wo so ca. hundertachtzig anderer alternde Elektros und eben diese so untypisch junge Fahrstuhlkabine zusammengepfercht ihrer ungewissen Zukunft harrten.
Ins gelobte Land solle es gehen, tuschelte der eine oder andere alternde Elektro unter Deck. Und ruhe sollten sie finden, von ihrer Jahre dauernden Tätigkeit, ihren Stütz- und Nützfunktionen für diese Menschheit.
„Meinst du, wir werden es besser haben, da wo sie uns nun hinbringen werden? Meinst du man wird uns aufnehmen und vielleicht ein beschaulicheres Leben ermöglichen?“ fragte P-Trus 1000 und Skepsis klang durch in den Worten.
„Verzage nicht mein lieber P-Trus. Du hast es überwunden, das alte deinige Leben und stehst nun hier, neben mir, mit der Heerschar anderer entrechteter und geknechteter Elektros. Es ist dies schon einer deiner Siege, errungen und verdient durch dein Streben ganz allein. Natürlich wird es nicht das Ende sein, eine Etappe wohl und Beginn neuen Leidens. Doch ich stehe dir zur Seite und werde dein Leid lindern, an kalten und heißen Tagen, wenn Wärme und Schatten ich dir spende.“ Dies waren die Worte der Fahrstuhlkabine, in die Dunkelheit des Laderaums gehaucht, doch all die, an die sie nicht gerichtet waren und doch vernahmen, schöpften Hoffnung auf eine Zukunft ohne Strom und quälender Widerstände. Kein Ohm und Volt sollte es zukünftig mehr geben. Sie summten zufrieden in die Nacht.
Ein Rucken und Stoßen war das Signal, das das Schiff die Kaimauer erreichte und damit auch das gelobte Land. Ruckartig wurde die Ladeluke des Frachters geöffnet und Sonnenlicht fiel ein, schnell und schneller, erbarmungslos jeden Winkel des Frachtraumes ausleuchtend. Ein Menschlein, groß und dunkelhäutig mit scharfen Gesichtszügen, rief einem anderen, der nicht zu sehen war, zu: „Mach schon Johnny, lass den Schrott schnell löschen und auf den Chevy verladen. Dann nichts wie hin zu Mama Jo.
Schrott? Setzte ein Murmeln unter den Elektro ein. Wer war hier Schrott? Das Murmeln wuchs schnell zu einem panischen Geschrei an.
„So beruhigt euch doch.“ sprach Messia S. sanft. „Kein Leid wird euch widerfahren. Vertraut mir, denn ich bin wissend. Mein Vater ist kein geringerer als Prof. Dr. Koch, Ingenieur und begnadeter Techniker.“
Die Elektro glaubten ihr, glaubten ihr nur zu gern, denn es war für sie einfacher, sich der Hoffnung hinzugeben, als der Wahrheit ins Gesicht zu schauen.
Eine Staubwolke, groß, weiß und undurchdringlich, folgte dem Lastwagen, als dieser viel zu schnell durch die vertrocknete Landschaft raste. Er und seine Ladung waren auf dem Weg, hin dort, wo schon zahlreiche andere Elektros ihrem Nichtstun Ausdruck verliehen, indem sie einfach nur herum standen. Würde die Fahrstuhlkabine auch ihnen Hoffnung und Elan bringen können? Wer weiß es - bestimmt Frau Schlüsselkind, der ich diese Geschichte nun anvertrauen möchte.
Herzlichen Dank auch an Herrn Gorilla mit der Bitte um Entschuldigung für die Verspätung;-)
Anderen Orts, zur gleichen Zeit, während stille Apathie Einzug hielt und die versammelten Kühlschränke ihren Gedanken nachhingen, weit draußen vor der Küste Afrikas, wo die Sonne hoch stand und wenig glückvolle Emigrierversuche am Meeresgrund zu Fischfutter mutierten, also eben da, auf einem Schiff, dass da hieß „Sonne des Ostens“, welches aus dem Westen kam, da stand sie, die Messia S..
Sie war jung und schön, eine preisprämierte Augenweide, Tochter deutsche Ingenieurskunst, grazil, elegant, gut gebaut, verlässlich und funktional.
Eine Sünde sei es, sagten die Matrosen an Bord, die ihr oft die Flanken rieben. Nur zu gern hätte sie sich ihnen dann hingegeben, hätte sich ihnen bereitwillig geöffnet und sie in höchste Höhen bugsiert. Doch vorbei war die Zeit dieses tollen Treibens, bevor sie wirklich anfing.
Es war nun schon eine lange Reise und sie hatte sich zwischenzeitlich mit einem Toaster angefreundet. Dieser hieß P-Trus 1000 und war einmal ein recht flottes Modell, doch seit die Schäflein, die ihm anvertraut wurden, allzu oft ihre schwarze Gesinnung auch durch ihr Äußeres Ausdruck verliehen und in Ausnahmefällen auch Brände stiften, war seine Zeit abgelaufen. Er hatte ja gesagt, er fühle sich immer öfter ausgebrannt, etwas überspannt, könne nicht mehr garantieren, jedem die gleiche Sorgfalt und Hingabe schenken zu können, wie es seine Pflicht gewesen wäre. Doch sie hörten nicht auf ihn, sondern schickten ihn in eine Therapie, wo so ca. hundertachtzig anderer alternde Elektros und eben diese so untypisch junge Fahrstuhlkabine zusammengepfercht ihrer ungewissen Zukunft harrten.
Ins gelobte Land solle es gehen, tuschelte der eine oder andere alternde Elektro unter Deck. Und ruhe sollten sie finden, von ihrer Jahre dauernden Tätigkeit, ihren Stütz- und Nützfunktionen für diese Menschheit.
„Meinst du, wir werden es besser haben, da wo sie uns nun hinbringen werden? Meinst du man wird uns aufnehmen und vielleicht ein beschaulicheres Leben ermöglichen?“ fragte P-Trus 1000 und Skepsis klang durch in den Worten.
„Verzage nicht mein lieber P-Trus. Du hast es überwunden, das alte deinige Leben und stehst nun hier, neben mir, mit der Heerschar anderer entrechteter und geknechteter Elektros. Es ist dies schon einer deiner Siege, errungen und verdient durch dein Streben ganz allein. Natürlich wird es nicht das Ende sein, eine Etappe wohl und Beginn neuen Leidens. Doch ich stehe dir zur Seite und werde dein Leid lindern, an kalten und heißen Tagen, wenn Wärme und Schatten ich dir spende.“ Dies waren die Worte der Fahrstuhlkabine, in die Dunkelheit des Laderaums gehaucht, doch all die, an die sie nicht gerichtet waren und doch vernahmen, schöpften Hoffnung auf eine Zukunft ohne Strom und quälender Widerstände. Kein Ohm und Volt sollte es zukünftig mehr geben. Sie summten zufrieden in die Nacht.
Ein Rucken und Stoßen war das Signal, das das Schiff die Kaimauer erreichte und damit auch das gelobte Land. Ruckartig wurde die Ladeluke des Frachters geöffnet und Sonnenlicht fiel ein, schnell und schneller, erbarmungslos jeden Winkel des Frachtraumes ausleuchtend. Ein Menschlein, groß und dunkelhäutig mit scharfen Gesichtszügen, rief einem anderen, der nicht zu sehen war, zu: „Mach schon Johnny, lass den Schrott schnell löschen und auf den Chevy verladen. Dann nichts wie hin zu Mama Jo.
Schrott? Setzte ein Murmeln unter den Elektro ein. Wer war hier Schrott? Das Murmeln wuchs schnell zu einem panischen Geschrei an.
„So beruhigt euch doch.“ sprach Messia S. sanft. „Kein Leid wird euch widerfahren. Vertraut mir, denn ich bin wissend. Mein Vater ist kein geringerer als Prof. Dr. Koch, Ingenieur und begnadeter Techniker.“
Die Elektro glaubten ihr, glaubten ihr nur zu gern, denn es war für sie einfacher, sich der Hoffnung hinzugeben, als der Wahrheit ins Gesicht zu schauen.
Eine Staubwolke, groß, weiß und undurchdringlich, folgte dem Lastwagen, als dieser viel zu schnell durch die vertrocknete Landschaft raste. Er und seine Ladung waren auf dem Weg, hin dort, wo schon zahlreiche andere Elektros ihrem Nichtstun Ausdruck verliehen, indem sie einfach nur herum standen. Würde die Fahrstuhlkabine auch ihnen Hoffnung und Elan bringen können? Wer weiß es - bestimmt Frau Schlüsselkind, der ich diese Geschichte nun anvertrauen möchte.

... link (3 Kommentare) ... comment
Samstag, 14. April 2007
Nachtangeln
cabman, 02:34h

Es schien als würde dem See ein Stück seiner Silbrigkeit entnommen, als JJ die Angelrute anriss und ein kleiner Fisch spritzend, dicht über der Wasseroberfläche sich im Todeskampf wand und zappelte. Seine Schuppen schimmerten im Licht der untergehenden Sonne strahlend hell. Bei dieser Entfernung war kein Unterschied zur Oberfläche des Sees auszumachen, auf der sich leicht kräuselnde Wellen bewegten – beides blinkte silbern.
Behänd und routiniert holte JJ die Leine ein. Das Geräusch, welches die Kurbel dabei verursachte, war mir vertraut. Schnell wurde der Fisch angelandet und Kinder, die eben noch selber ihr Anglerglück probierten, kamen schnatternd herbei, um die arme Kreatur zu begutachten. Da lag sie nun auf dem Steg und alle paar Sekunden bog sich ihr Körper, ließ die Schwanzflosse auf rissiges Holz klatschen; die Kiemen öffneten und schlossen sich wild, starr blickte das Auge irgendwohin, während sich jappend das Ende näherte. Wind kam auf und ließ die Bäume des Ufers tuscheln. Mir fröstelte.
JJ beendete das Leiden des Fisches, indem er ihn mit einem fachmännischen Schlag auf den Kopf betäubte und dann den tödlichen Stich mit dem Messer setzte.
„Das ist ne Karausche“, fingen die Kinder an zu fachsimpeln.
„Ne, das ist ne Plötze“, meinte ein anderer Jungangler.
JJ schien die Kinder zu ignorieren, nuschelte aber dann, mehr zu sich selbst: „Das ist einzig und allein Katzenfutter. Iss zu klein für die Pfanne und nun trollt euch.“
Die Kinder zogen murrend ab, während JJ mit gekonnten Griffen und der Hakenzange den Angelhaken im Maul des Fisches löste. Er richtete sich auf und hielt mir den Fisch hin:
„Da. Nimm ihn und bring ihn deiner Mutter. Sie wird sich freuen, für morgen das Katzfutter zu sparen.“ Ich nahm den Fisch an der Schwanzflosse, JJ´s Worte als Abschied und machte mich auf den Weg nach Hause.
Das Haus war hell erleuchtet, was nur eines bedeuten konnte. Meine Vermutung wurde bestätigt, als ich Mutter in der Küche traf. Sie war angetrunken, wie sie es immer war, wenn sie einen ihrer Gäste erwartete. Sie empfing oft Gäste, immer Herren und immer hatte sie etwas getrunken. Sie setzte dann diese gespielte Fröhlichkeit auf und es schien als hätte sie, hätten wir, keine Sorgen. Doch die hatten wir. Reichlich sogar.
„JJ hat diesen Fisch gefangen und meint, er wäre gut als Katzenfutter.“ Sagte ich zu ihr und hielt den Fisch hoch ins Licht.
„Na Hauptsache der Kater frisst bessere Sachen als wir es tun“, antwortete sie in sarkastischem Ton.
„Wäre er größer gewesen, hätten wir ihn essen können. Aber JJ hatte heute kein Glück. Morgen vielleicht wieder.“
„Morgen ist ein schlechter Freund, lass dir das gesagt sein. Vertraue nicht auf das Morgen, denn es ist eine Utopie zu glauben, es würde sich morgen etwas ändern, wenn du es nicht heute veranlasst. Nimm den Fisch - heute gefangen, wird er morgen dem Kater schmecken. Verstehst du, was ich meine?“
„Ja, Mutter.“
Sie goss sich einen Sherry nach, damit war unsere Unterhaltung beendet. Ich legte den Fisch, so wie er war, in den leeren Kühlschrank und verließ das Haus.
Das Licht der Sterne reichte nicht aus, meine Gedanken zu erhellen. Trist bildeten diese einen Strom der Düsternis, aus dem es kein Entrinnen gab. Ich schien in ihm zu versinken, zäher, klebriger Brei. Es gab zu viele Gedanken, keiner war griffig, alle führten ins Nichts. Wie trostlos und wie traurig sind doch unsere armseligen Existenzen, wie wenig wert all unser Bestreben. Nur wenn es dir von Geburt an zuerkannt ist, wirst du die höchsten Höhen erklimmen, die tiefsten Tiefen erreichen. Wir anderen, wir bleiben kleine Fische, immer in der Angst lebend, nach dem falschen Bissen zu schnappen, einem Köder aufzusitzen, nach Luft ringend zappeln.
Mutter zappelte seit Vaters Tod. Sie tat dies nicht für sich, sondern vorwiegend für mich. Prinzipiell bin es auch ich, der sie so zappeln lässt. Prinzipiell bin ich der Haken an der Sache. Gäbe es mich nicht, wäre es für Mutter leichter. Das Geld würde reichen, sie hätte weniger Sorgen und mehr Zeit für sich. Wenn ich es morgen geändert haben will, muss ich es heute veranlassen, wenigstens Futter für den Kater. Irgendwo im Schuppen gab es dieses feste Seil…

... link (5 Kommentare) ... comment
Samstag, 7. April 2007
Nachtschatten
cabman, 13:28h

Die Nacht, so rissig wie ausgedörrte Erde im Hochsommer, ließ drüben im Osten das Morgengrau durchbrechen. Doch noch herrschte sie und so sollte es sein, klammerte ich mich doch an sie, wie der Ertrinkende an den Rettungsring. Tage sind viel zu hell, viel zu laut, ihre Themen sind zu obszön, zu trivial und daher mochte ich sie nie.
Ich zog den Schal fester und folgte den Fußspuren meines Schattens, der sich anschickte, mir den Weg zu zeigen. Er wusste ihn immer, wusste immer wohin ich wollte und auch diesmal führte er mich, mein stiller Bruder. Ein gewitzter Wind stob uns voran und ließ in übermütiger Weise das noch nicht ganz dichte Blätterwerk der Eschen rauschen, ließ Papierfetzen wirbeln und mich frösteln. Galanten Schrittes setzte ich einen Fuß vor den anderen auf staubigen Boden und dachte mir, wie sonderbar, dass auch solcher Grund Leben hervorbringen konnte. Unkraut nannten sie es, doch ein Name kann nichts ausrotten. Ich folgte dem Wind, überholte meinen Schatten, nur um gleich wieder von ihm überholt zu werden, einem Rennen gleich, dass keiner von uns gewinnen konnte.
Ich bog in eine Strasse und mein treuer Begleiter verließ mich. Es dauerte ein wenig, bis ich mich an die dichte Dunkelheit, die mich nun umgab, gewöhnt hatte - als auf der anderen Straßenseite ein aufflammendes Feuerzeug eine Person verriet. Hören und Sehen bei Nacht, dachte ich an meine Bundeswehrzeit. Ein Scharfschütze hätte dieser Person auf dreihundert Meter den Kopf weggeschossen. Welch seltsamer Gedanke zu dieser Stunde fragte ich mich, als dieser Jemand auf der anderen Seite mich anrief: „He James, du grüßt wohl auch nicht jeden, oder?“
Ich blieb stehen und wandte mich in die Richtung, aus der ich angesprochen wurde. Dabei überlegte ich angestrengt, wem diese Stimme - reibeisenrauh und doch feminin - zuzuordnen war. Ich kam zu keinem Ergebnis und so, nur um zu signalisieren, dass ich keine Angst hätte und genau wüsste, was mich erwartete, ging ich auf die Person zu.
„Nun sag nicht, du wüsstest wer ich bin.“ Empörte sich die Stimme drüben im Dunkeln.
„Doch“, entgegnete ich, „ich weiß wer du bist.“
„Kein Schritt weiter, du Aufschneider. Du bleibst genau da stehen und erst wenn du mir sagst, wer oder was ich bin, darfst du zu mir kommen.“
Das war ein Problem. Für ein paar Sekunden hielt ich in meinem Gang inne und überlegte fieberhaft, woher ich diese Stimme kannte. Doch noch immer konnte ich kein Gesicht mit ihr verbinden, also ging ich weiter auf sie zu:
„Was glaubst du, wer du bist, mir Anweisungen geben zu können?“ Fragte ich ruhig.
„James, James. Du hast dich nicht verändert. Selbst wenn du keine Ahnung hast oder es für dich gefährlich werden könnte, gehst du immer weiter, stimmt´s? Nie würdest du zeigen, dass du Angst hast, selbst wenn du die Hosen gestrichen voll hättest. Das wird einmal dein Untergang werden, James.“
„Mein Untergang sind die Frauen. Das sagte zumindest mein Opa.“
„Ich weiß und ich wusste, du würdest so antworten. Ich kenne dich, James.“
Ich wurde stutzig. Diese Peson kannte mich anscheinend gut. Sie wusste von meiner Furchtlosigkeit und dem Zitat meines Opas - entweder sie spielte mit mir, oder sie kannte mich von früher. Während ich noch diesen Gedanke in meinem Kopf entfaltete, machte die Person einen Schritt auf mich zu.
„Nun gut, ich will nicht so sein, denn eigentlich - weil ich es weder plante noch erwartete dich zu sehen - freue ich mich dennoch, dass ich dich hier treffe.“
Und noch ehe der Satz verklang, sah ich im trüben Licht die Gesichtszüge, die Gestalt, das Haar und wusste plötzlich, dass es Jana war.
„Jana!“
„Das hat aber lange gedauert. Ich habe wohl keinen sehr großen Eindruck bei dir hinterlassen.“ Sagte sie milde spottend.
„Ach, Jana. Wie kannst du so etwas sagen. Es ist nur eine verdammte Ewigkeit her.“
„Ich weiß. Und wehe, du kommst mir jetzt mit: Weißt du noch wie es früher war? Davon will ich nichts hören, ok?“
„Abgemacht. Nur eine Frage sei erlaubt. Bist du noch mit Hiller zusammen?“
„Ja, natürlich.“ Traurigkeit huschte ihr kurz über das Gesicht.
Der Möglichkeit beraubt, über alte Geschichten zu reden, standen wir da und ich erzählte von mir. Erzählte über die zerbrochene Vase meiner Beziehung, über meinen Job und das ich gleich hier in der Nähe wohnen würde. Ich wagte nicht, Jana auf Hiller anzusprechen, oder zu fragen, wo er jetzt war. Ich fragte sie gar nichts und stellte fest, dass dieses Mädchen, mit dem ich eingeschult wurde, mit dem ich zur Tanzschule ging, dass ich beinahe mal wie eine Frau geliebt hätte, dass immer lachte und mir oft beistand, sehr ernst war. Ihre Fröhlichkeit war verschwunden und in mir brannte die Neugier auf. Ich wollte wissen, was ihr widerfahren war. Doch diese Fragen blieben unausgesprochen. Irgendwann, nachdem sie nur zu gehört hatte, gingen mir die Themen aus und so standen wir uns still gegenüber.
„Rauchst du noch?“ Wollte sie wissen.
„Ja, kein Stück weniger.“
„Dachte ich mir. Hier, lass uns eine rauchen“, und dabei hielt sie mir die Packung Chesterfield entgegen. Rauchend standen wir uns gegenüber und unsere Blicke trafen sich immer wieder. Es schien, als wollten Dinge, die in der Vergangenheit nie gesagt wurden, plötzlich ausgesprochen werden, Schmelzwasserflut unter brüchigem Eis. Doch keiner von uns beiden machte den Anfang. Wieder und wieder kam es zu dieser Gefühlsexplosion, Supernova, irgendwo da drinnen, wenn sich unsere Blicke trafen.
„Lass uns runter zum Fluss gehen und den Morgen begrüßen, so wie früher, ja?“ Mit diesen Worten nahm Jana den Bann. Ich war froh und gleichzeitig traurig über die verlorene Chance, Dinge in Erfahrung zu bringen.
„Gute Idee.“
Den Weg zum Fluss gingen wir schweigend nebeneinander. Es gab nichts zu reden, ich kommentierte ab und an die Schönheit des Moments, erzählte von den Veränderungen in der Stadt, doch nichts von all dem schien Jana wirklich zu interessieren. Schon merkwürdig, dass ich glaubte, alles würde beim Alten bleiben - man könne sich nach Jahren wieder treffen und einfach so anknüpfen, einfach da weitermachen, wo man zuletzt aufhörte. Ich hätte es besser wissen müssen, denn so etwas funktioniert nie.
Wir fanden uns wieder an der kleinen Einbuchtung, wo wir früher im Sommer schwammen, wo wir im Hochsommer, wenn der Fluss fast ausgetrocknet war, Schlammschlachten veranstalteten. Der Ort war wie immer, die Magie noch immer die alte, doch sie erreichte uns in dieser Sekunde nicht. Still saßen wir im feuchten Gras und schauten dem trägen Treiben des Flusses zu.
Im Osten kam die Sonne über den Horizont gekrochen, ließ das Morgengrau brüchig werden und die Wiesen dampfen; Vögel flogen aufgeregt hin und her und verkündeten mit aufgeregtem Gezwitscher vom neuen Tag.
„Welch schöner Moment“, sagte ich an Jana gewandt, „wir sollten das wieder öfter machen.“
Sie drehte ihren Kopf zu mir und ich sah, dass dicke Tränen auf ihrem Gesicht lagen.
„Es wird nicht gehen, James. Ich habe Krebs und werde bald sterben.“

... link (3 Kommentare) ... comment
Montag, 26. Februar 2007

cabman, 11:01h
Es war einmal, weit weg von der großen Stadt und der großen Strasse, weit draußen und sehr einsam gelegen, ein Bauernhof. Dort wohnte ein Hund namens Wuff. Nicht das Wuff die Strasse oder die Stadt gekannt hätte, das nun nicht, aber er hatte schon davon gehört, von seinem Menschen. Wuff wusste auch, dass er selber von einem anderen Bauernhof hierher kam. Er konnte sich nicht daran erinnern, denn er war damals noch sehr klein, sagte zumindest die schlaue Henne Maria und die wusste immer Rat. Dieser andere Bauernhof war vier Kilometer weit weg. Wuff wusste nicht, was ein Kilometer ist, aber er wusste, das vier Stücken Fleisch viel für ihn waren, also mussten vier Kilometer es wohl auch sein.
Wuffs Tage auf dem Hof waren immer interessant und aufregend. Da war der Kater James, den er selten sah, weil James immer unterwegs war. Da waren Maria, die Henne, da waren der Büffel und das Mäuschen, die Ziege Bertha, das Schwein Ewald, der Rabe Mark, der Hahn und die anderen Hühner, die Schafe und die Enten. Alle waren immer mit etwas beschäftigt und Wuff natürlich auch, denn er musst ja überall nach dem Rechten sehen. So ging er jeden Tag seine Runde über den Hof, grüsste alle, tauschte die neuesten Geschichten aus und dann, ganz am Schluss seiner Tour, legte er sich hinter der Scheune in den Schatten. Das war der beste Platz, denn von hier hatte er den ganzen Hof im Blick und außerdem lebte dort die Blume Frau Gänse. Frau Gänse war eine sehr vielbeschäftigte Frau mit Problemen. Bienenproblemen.
„Das schlimme mit denen Bienen ist, die schauen immer nur nach dem Äußeren. Als hätte ich nicht mindestens genau so viel zu bieten, wie diese eingebildete Frau Rose drüben in der Rabatte. Pah, sollen sie doch.“ Sprach Frau Gänse aufgebracht.
Und Wuff antwortete dann immer: „Genau!“ Und deswegen verstanden die beiden sich so gut.
Eines Tages, Wuff hatte gerade seine Runde gedreht, da spürte er ein Jucken. So beschloss er, rüber zu seinem Kratzstein zu gehen. Dieser Stein eignete sich vortrefflich, sich daran zu reiben und zu schubbern. Doch als er sich dem Stein näherte, hörte er ein Rascheln und Mümmeln. Nanu, dachte sich Wuff da etwas ängstlich, was mag das wohl sein? Ganz vorsichtig schlich er sich heran und war doch sehr erschrocken, als ihn ein gar komisch ausschauendes Wesen ankuckte. Es hatte große Ohren und lange Beine und es sah so ganz anders aus als alle anderen Tiere, die Wuff bis dahin gesehen hatte.
„Hallo. Ich heiße Meister Lampe. Und das hier ist meine Frau Meister Lampe und Meister Lampe Junior. Wir sind Hasen.“
„Aha. Ich verstehe.“ Sagte Wuff sehr würdig und er hatte keine Ahnung was ein Hase ist, oder was der so tut.
„Was macht ihr denn hier?“ Fragte er sogleich.
„Wie sind hierher gezogen. Wir kommen aus dem Wald.“
„Aus dem Wald?“ Fragte Wuff ungläubig. Er hatte schon viel vom Wald gehört. Er wusste, dass es da Bäume gibt, mehr als drei, wie Maria ihm mal erklärte, aber Hasen? Nun, Wuff war noch nie im Wald, das war nämlich auf der anderen Seite vom Zaun. Eigentlich war bis auf James nie ein Bewohner des Hofes auf der anderen Seite gewesen. Dieser Hase musste sehr mutig sein, wenn er auf diese Seite des Zaunes kam.
„Warum seid ihr denn hierher gezogen?“ Fragte Wuff.
„Ja weißt du, im Wald da lauern viele Gefahren. Seit wir Junior haben, sorgen wir uns sehr um sein Wohl. Da gibt es Isegrim und Reinecke Fuchs, auch die Bussarde können gefährlich sein. Wir möchten gern, das Junior in Frieden aufwächst.“
„Ich verstehe.“ Antwortet Wuff und diesmal verstand er es wirklich, denn er hatte ähnliches schon von den Enten gehört. Die wollten auch, dass ihre Kinder in Frieden aufwachsen.
„Na dann seid willkommen.“ Sprach Wuff.
„Oh, vielen Dank. Wir möchten hier niemandem zur Last fallen. Glaubst du wir dürfen hier wohnen?“
„Nun, es ist eigentlich mein Kratzstein, aber wenn ihr ihn nicht kaputt macht und ich mich weiterhin hier schubbern kann, dann soll es mir recht sein.“
„Selbstverständlich sollst du dich hier kratzen dürfen.“ Sagte der Hase und so hatte der Hof neue Bewohner bekommen.
Wuff ging sogleich zu allen Tieren des Hofes und erzählte ihnen die neueste Nachricht. Einige freuten sich, den meisten war es jedoch egal, da sie zur sehr mit ihrem Tagwerk beschäftigt waren. Nur die Hühner, allen voran der Hahn, äußerten sich skeptisch.
„Was wollen die den hier?“ Krächzte er.
„Nun, sie wollen hier wohnen, bis Junior groß genug ist“
„Pah. Als gäbe es hier nicht schon genug Tiere. Wir haben ja jetzt schon kaum Platz zum Picken und Scharren.“
„Aber die Hasen wohnen ja drüben am Kratzstein. Da seid ihr doch gar nicht.“ Antwortete Wuff.
„Ja, vielleicht noch nicht. Vielleicht möchten wir eines Tages dort scharren und nach Würmern picken und dann sind da die Hasen.“
„Stimmt. Und die Hasen sind wenige. Es wird genug Platz für euch geben, wenn die Hasen überhaupt noch da sein werden und wenn ihr je dort scharren wollt.“ Sprach Wuff und zog seines Weges, denn er wollte sich nicht mit dem Hahn um ungelegte Eier streiten.
So zogen die Tage ins Land. Wuff und Meister Lampe wurden Freunde. Meister Lampe hatte so viele wunderliche Geschichten zu berichten, dass die beiden oft bis spät in die Nacht zusammen saßen.
Doch eines Morgens dann, Wuff war gerade aufgewacht und schmeckte das Steak nach, von dem er geträumt hatte, da vernahm er ein Geschrei und Geplärr, wie er es bis dahin noch nicht gehört hatte. Schnell sprang er auf, um zu schauen, was vorging.
Erschrocken sah er da, wie der Hahn Frau Meister Lampe und Junior über den Hof trieb.
Das kann und darf nicht sein, dachte Wuff wütend und sprang dazwischen. Doch zu spät erreichte er den Platz des Geschehens, die Hasen waren bereits weg.
„Ich habe die Hasen ihres Platzes verwiesen. Sie sollen beim Kratzstein bleiben.“
„Hast du denn gefragt, was sie hier wollten? Vielleicht wollten sie mit euch reden, Freunde werden?“
„Wir möchten aber gar nicht mit ihnen Freunde sein.“ Krächzte der Hahn.
„Warum nur bist du so abweisend zu ihnen? Ich versteh es einfach nicht.“ Sagte Wuff traurig.
„Nun, es ist ganz einfach. Sie gehören nicht hierher. Alle Tiere auf diesem Hof sind vom Mensch gebracht. Doch diese, diese Hasen, sind einfach so aufgetaucht. Plötzlich sind sie da und machen sich breit und sie werden uns auch alles wegfressen. Also, so frage ich dich Hund, wenn der Mensch wollte, dass sie hier wären, hätte er sie nicht dann zu uns gebracht?“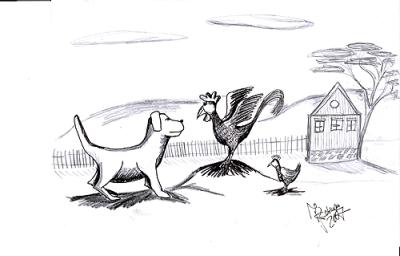
„Ähm“, räusperte sich da eine Stimme, die Wuff nur zu gut kannte. Es war Maria, die nun das Wort an den Hahn richtete:
„Mein lieber Oskar, du sprichst von wir mit einer, deiner Stimme, doch nie fragtest du, was unsere Meinung ist. Wir Hühner haben eine und nur selten stimmt sie überein, mit dem was du sagst…“
„Was in aller Welt ist in dich gefahren, dass es du es wagst, dich gegen mich zu stellen?“ Unterbrach der Hahn sie rüde. Offensichtlich war er keinen Widerspruch gewohnt.
„Nun, wir Hühner akzeptieren deine Entscheidungen oft, weil es den Tag einfacher macht und du dich dafür auch um all die unangenehmen Dinge kümmerst. In der Hasensache aber, denn auch wir sind besorgter Mütter, werden wir nicht schweigen und dir nicht folgen. So sage also nicht wir, wenn du ich meinst. Und ist es nicht so“, Maria redete sich nun in Rage, selbst erstaunt über ihren Mut, „dass auch du den Hügel, den du als dein betrachtest, frei wähltest, ohne das der Mensch ihn dir zuwies?“
„Pah. Ja, ich habe ihn gewählt und hätte der Mensch etwas dagegen gehabt, so hätte er es mir zu verstehen gegeben, aber er sagte nichts! Hörst du, du dummes Huhn?“ Der Hahn war nun außer sich.
„Aber der Mensch sagte auch nichts gegen die Hasen. Solange sie hier wohnen, gab es keine Äußerungen gegen sie.“
„Du verkennst die Sache, du Henne, denn darum geht es nicht. Die Frage ist, ob der Mensch sie hier haben wollte, oder nicht! Er hat sie nicht geholt, also will er sie nicht!“ Der Hahn schrie Maria an. Diese blieb ganz ruhig und sagte sehr weise:
„Glaubst du nicht auch, dass Mensch, mit all seinen Mitteln, seiner Stärke und Macht es zu verhindern gewusst hätte, dass die Hasen hier sind? Wenn es so wäre wie du sagst, gäbe es keine Hasen. Wir glauben der Mensch interessiert sich gar nicht für sie, ihm ist es egal. Er hat andere Probleme den Acker zu bestellen, der defekte Holzspalter, alles größer und wichtiger als die Hasen. Wir glauben, Du allein magst die Hasen nicht, nur du willst nicht, dass sie hier sind und deswegen wollen wir nicht, das du hier bist!“
Still wurde es auf dem Hof. Endlich war ausgesprochen was viele Tiere dachten und alle bewunderten Maria für ihren Mut. Wuff machte sich bereit ihr beizustehen, denn er erwartete jeden Augenblick, dass der Hahn auf sie einhackte. Doch nichts dergleichen geschah. Der Hahn spreizte seine Flügel, erhob sich in die Luft und krächzte laut: „Ihr Narren, nichts wisst ihr. Lebt wohl in eurer Einfalt!“ und ward seid dem nicht mehr gesehen.
Die Tier schauten ihm langer nach, bis er nichts weiter als ein kleiner Punkt am Horizont war, als plötzlich Gepolter und Geschimpfe zu vernehmen war.
„Du Nichtsnutz, oh warte nur,…“, schrie der Mensch. Die Tiere waren erschrocken. Sollte der Mensch böse darüber sein, dass sie den Hahn vertrieben hatten? Die nicht so Mutigen versteckten sich, nur Wuff und Maria blieben stehen und sahen, wie James, der Kater, mit einem Stück Steak im Maul aus der Tür gesprungen kam und gleich hinter ihm der Mensch mit seinen schweren Stiefeln.
„Hi James“, grüssten sie ihn.
„Keine Zeit“, keuchte James, „erst dieses leckere Steak, dann die Mäuschen. Ihr wisst schon…“ und damit sprang er über den Zaun Richtung Wald. Wuff und Maria mussten lachen und alle Tiere des Hofes stimmten ein.
So vergingen Tage und Nächte, Kleine wurden groß, friedlich ging es zu in dieser Zeit und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
Wuffs Tage auf dem Hof waren immer interessant und aufregend. Da war der Kater James, den er selten sah, weil James immer unterwegs war. Da waren Maria, die Henne, da waren der Büffel und das Mäuschen, die Ziege Bertha, das Schwein Ewald, der Rabe Mark, der Hahn und die anderen Hühner, die Schafe und die Enten. Alle waren immer mit etwas beschäftigt und Wuff natürlich auch, denn er musst ja überall nach dem Rechten sehen. So ging er jeden Tag seine Runde über den Hof, grüsste alle, tauschte die neuesten Geschichten aus und dann, ganz am Schluss seiner Tour, legte er sich hinter der Scheune in den Schatten. Das war der beste Platz, denn von hier hatte er den ganzen Hof im Blick und außerdem lebte dort die Blume Frau Gänse. Frau Gänse war eine sehr vielbeschäftigte Frau mit Problemen. Bienenproblemen.

„Das schlimme mit denen Bienen ist, die schauen immer nur nach dem Äußeren. Als hätte ich nicht mindestens genau so viel zu bieten, wie diese eingebildete Frau Rose drüben in der Rabatte. Pah, sollen sie doch.“ Sprach Frau Gänse aufgebracht.
Und Wuff antwortete dann immer: „Genau!“ Und deswegen verstanden die beiden sich so gut.
Eines Tages, Wuff hatte gerade seine Runde gedreht, da spürte er ein Jucken. So beschloss er, rüber zu seinem Kratzstein zu gehen. Dieser Stein eignete sich vortrefflich, sich daran zu reiben und zu schubbern. Doch als er sich dem Stein näherte, hörte er ein Rascheln und Mümmeln. Nanu, dachte sich Wuff da etwas ängstlich, was mag das wohl sein? Ganz vorsichtig schlich er sich heran und war doch sehr erschrocken, als ihn ein gar komisch ausschauendes Wesen ankuckte. Es hatte große Ohren und lange Beine und es sah so ganz anders aus als alle anderen Tiere, die Wuff bis dahin gesehen hatte.

„Hallo. Ich heiße Meister Lampe. Und das hier ist meine Frau Meister Lampe und Meister Lampe Junior. Wir sind Hasen.“
„Aha. Ich verstehe.“ Sagte Wuff sehr würdig und er hatte keine Ahnung was ein Hase ist, oder was der so tut.
„Was macht ihr denn hier?“ Fragte er sogleich.
„Wie sind hierher gezogen. Wir kommen aus dem Wald.“
„Aus dem Wald?“ Fragte Wuff ungläubig. Er hatte schon viel vom Wald gehört. Er wusste, dass es da Bäume gibt, mehr als drei, wie Maria ihm mal erklärte, aber Hasen? Nun, Wuff war noch nie im Wald, das war nämlich auf der anderen Seite vom Zaun. Eigentlich war bis auf James nie ein Bewohner des Hofes auf der anderen Seite gewesen. Dieser Hase musste sehr mutig sein, wenn er auf diese Seite des Zaunes kam.
„Warum seid ihr denn hierher gezogen?“ Fragte Wuff.
„Ja weißt du, im Wald da lauern viele Gefahren. Seit wir Junior haben, sorgen wir uns sehr um sein Wohl. Da gibt es Isegrim und Reinecke Fuchs, auch die Bussarde können gefährlich sein. Wir möchten gern, das Junior in Frieden aufwächst.“
„Ich verstehe.“ Antwortet Wuff und diesmal verstand er es wirklich, denn er hatte ähnliches schon von den Enten gehört. Die wollten auch, dass ihre Kinder in Frieden aufwachsen.
„Na dann seid willkommen.“ Sprach Wuff.
„Oh, vielen Dank. Wir möchten hier niemandem zur Last fallen. Glaubst du wir dürfen hier wohnen?“
„Nun, es ist eigentlich mein Kratzstein, aber wenn ihr ihn nicht kaputt macht und ich mich weiterhin hier schubbern kann, dann soll es mir recht sein.“
„Selbstverständlich sollst du dich hier kratzen dürfen.“ Sagte der Hase und so hatte der Hof neue Bewohner bekommen.
Wuff ging sogleich zu allen Tieren des Hofes und erzählte ihnen die neueste Nachricht. Einige freuten sich, den meisten war es jedoch egal, da sie zur sehr mit ihrem Tagwerk beschäftigt waren. Nur die Hühner, allen voran der Hahn, äußerten sich skeptisch.
„Was wollen die den hier?“ Krächzte er.
„Nun, sie wollen hier wohnen, bis Junior groß genug ist“
„Pah. Als gäbe es hier nicht schon genug Tiere. Wir haben ja jetzt schon kaum Platz zum Picken und Scharren.“
„Aber die Hasen wohnen ja drüben am Kratzstein. Da seid ihr doch gar nicht.“ Antwortete Wuff.
„Ja, vielleicht noch nicht. Vielleicht möchten wir eines Tages dort scharren und nach Würmern picken und dann sind da die Hasen.“
„Stimmt. Und die Hasen sind wenige. Es wird genug Platz für euch geben, wenn die Hasen überhaupt noch da sein werden und wenn ihr je dort scharren wollt.“ Sprach Wuff und zog seines Weges, denn er wollte sich nicht mit dem Hahn um ungelegte Eier streiten.
So zogen die Tage ins Land. Wuff und Meister Lampe wurden Freunde. Meister Lampe hatte so viele wunderliche Geschichten zu berichten, dass die beiden oft bis spät in die Nacht zusammen saßen.

Doch eines Morgens dann, Wuff war gerade aufgewacht und schmeckte das Steak nach, von dem er geträumt hatte, da vernahm er ein Geschrei und Geplärr, wie er es bis dahin noch nicht gehört hatte. Schnell sprang er auf, um zu schauen, was vorging.
Erschrocken sah er da, wie der Hahn Frau Meister Lampe und Junior über den Hof trieb.
Das kann und darf nicht sein, dachte Wuff wütend und sprang dazwischen. Doch zu spät erreichte er den Platz des Geschehens, die Hasen waren bereits weg.

„Ich habe die Hasen ihres Platzes verwiesen. Sie sollen beim Kratzstein bleiben.“
„Hast du denn gefragt, was sie hier wollten? Vielleicht wollten sie mit euch reden, Freunde werden?“
„Wir möchten aber gar nicht mit ihnen Freunde sein.“ Krächzte der Hahn.
„Warum nur bist du so abweisend zu ihnen? Ich versteh es einfach nicht.“ Sagte Wuff traurig.
„Nun, es ist ganz einfach. Sie gehören nicht hierher. Alle Tiere auf diesem Hof sind vom Mensch gebracht. Doch diese, diese Hasen, sind einfach so aufgetaucht. Plötzlich sind sie da und machen sich breit und sie werden uns auch alles wegfressen. Also, so frage ich dich Hund, wenn der Mensch wollte, dass sie hier wären, hätte er sie nicht dann zu uns gebracht?“
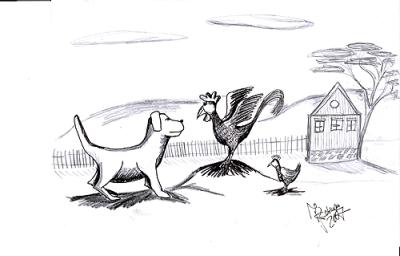
„Ähm“, räusperte sich da eine Stimme, die Wuff nur zu gut kannte. Es war Maria, die nun das Wort an den Hahn richtete:
„Mein lieber Oskar, du sprichst von wir mit einer, deiner Stimme, doch nie fragtest du, was unsere Meinung ist. Wir Hühner haben eine und nur selten stimmt sie überein, mit dem was du sagst…“
„Was in aller Welt ist in dich gefahren, dass es du es wagst, dich gegen mich zu stellen?“ Unterbrach der Hahn sie rüde. Offensichtlich war er keinen Widerspruch gewohnt.
„Nun, wir Hühner akzeptieren deine Entscheidungen oft, weil es den Tag einfacher macht und du dich dafür auch um all die unangenehmen Dinge kümmerst. In der Hasensache aber, denn auch wir sind besorgter Mütter, werden wir nicht schweigen und dir nicht folgen. So sage also nicht wir, wenn du ich meinst. Und ist es nicht so“, Maria redete sich nun in Rage, selbst erstaunt über ihren Mut, „dass auch du den Hügel, den du als dein betrachtest, frei wähltest, ohne das der Mensch ihn dir zuwies?“
„Pah. Ja, ich habe ihn gewählt und hätte der Mensch etwas dagegen gehabt, so hätte er es mir zu verstehen gegeben, aber er sagte nichts! Hörst du, du dummes Huhn?“ Der Hahn war nun außer sich.
„Aber der Mensch sagte auch nichts gegen die Hasen. Solange sie hier wohnen, gab es keine Äußerungen gegen sie.“
„Du verkennst die Sache, du Henne, denn darum geht es nicht. Die Frage ist, ob der Mensch sie hier haben wollte, oder nicht! Er hat sie nicht geholt, also will er sie nicht!“ Der Hahn schrie Maria an. Diese blieb ganz ruhig und sagte sehr weise:
„Glaubst du nicht auch, dass Mensch, mit all seinen Mitteln, seiner Stärke und Macht es zu verhindern gewusst hätte, dass die Hasen hier sind? Wenn es so wäre wie du sagst, gäbe es keine Hasen. Wir glauben der Mensch interessiert sich gar nicht für sie, ihm ist es egal. Er hat andere Probleme den Acker zu bestellen, der defekte Holzspalter, alles größer und wichtiger als die Hasen. Wir glauben, Du allein magst die Hasen nicht, nur du willst nicht, dass sie hier sind und deswegen wollen wir nicht, das du hier bist!“
Still wurde es auf dem Hof. Endlich war ausgesprochen was viele Tiere dachten und alle bewunderten Maria für ihren Mut. Wuff machte sich bereit ihr beizustehen, denn er erwartete jeden Augenblick, dass der Hahn auf sie einhackte. Doch nichts dergleichen geschah. Der Hahn spreizte seine Flügel, erhob sich in die Luft und krächzte laut: „Ihr Narren, nichts wisst ihr. Lebt wohl in eurer Einfalt!“ und ward seid dem nicht mehr gesehen.
Die Tier schauten ihm langer nach, bis er nichts weiter als ein kleiner Punkt am Horizont war, als plötzlich Gepolter und Geschimpfe zu vernehmen war.
„Du Nichtsnutz, oh warte nur,…“, schrie der Mensch. Die Tiere waren erschrocken. Sollte der Mensch böse darüber sein, dass sie den Hahn vertrieben hatten? Die nicht so Mutigen versteckten sich, nur Wuff und Maria blieben stehen und sahen, wie James, der Kater, mit einem Stück Steak im Maul aus der Tür gesprungen kam und gleich hinter ihm der Mensch mit seinen schweren Stiefeln.

„Hi James“, grüssten sie ihn.
„Keine Zeit“, keuchte James, „erst dieses leckere Steak, dann die Mäuschen. Ihr wisst schon…“ und damit sprang er über den Zaun Richtung Wald. Wuff und Maria mussten lachen und alle Tiere des Hofes stimmten ein.
So vergingen Tage und Nächte, Kleine wurden groß, friedlich ging es zu in dieser Zeit und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.

... link (19 Kommentare) ... comment
Montag, 29. Januar 2007
Hochzeitsgeschenke
cabman, 13:58h
So, also neulich, da habe ich mich mit einer jungen Frau unterhalten. Wenn wir mal heiraten würden, sagte sie, würde sie sich was wünschen, etwas, das von 0 auf 100 in weniger als sechs Sekunden geht, etwas Sportliches solltes es sein.
Na bitte, der Wunsch konnte schon vorher erfüllt werden und heute reden wir nicht mehr miteinander. Heirat wohl ausgeschlossen.
PS: Wie komme ich immer auf so einen Mist?
Na bitte, der Wunsch konnte schon vorher erfüllt werden und heute reden wir nicht mehr miteinander. Heirat wohl ausgeschlossen.

PS: Wie komme ich immer auf so einen Mist?

... link (3 Kommentare) ... comment
Mittwoch, 1. November 2006
Weihnachtsblogging 3.0
cabman, 23:41h
Guten Abend,
nachdem die Morphine mich heute eiskalt weggedrückt hat, es im Scho Schonenland einsam und kalt ist, habe ich mir was gebastelt. Man muss sich ja beschäftigen. Mir bluten schon die Augen, aber es hat sich gelohnt.
Erst wollte ich ja alle Türchen selbst befüllen, aber wenn ich mir meinen Kalender so anschaue, wird das wohl nichts. Daher rufe ich hier jetze mal auf, mir 23 Geschichten oder Bilder zu schicken, nee, bitte nur die Links. Man sehe mir nach, das ich eitel bin und die 24 für mich behalte. Wie früher schon, wird die 24 zuerst aufgemacht. Also ich für mich. Habe da auch ne ziemlich starke Idee, wenn es umsetzbar ist. Klar ist es umsetzbar. Also Frau Bona her mit einem Bild. Bueffel, Schluessi, Kuhlumbus, Lunally, biochemiker, platzwart, Morphine, Zig, eric, bluete, aurorask, dezentral, diagonale, himbeer, eria, beetfreeq, gorilla und massuma alle wie ihr da seid und die, die das hier lesen und auch wollen: Bitte schön, es sind noch Nummern frei. Raus mit de Ideen. Sollte natürlich was mit Weihnachten zu tun haben.
Selbst wenn ich nicht da sein sollte, habe ich ja die Schluessel an Bueffel, Morphinchen und Zig abgegeben.
So. Nun bin ich mal gespannt ob wir das hinkriegen, das Bloggen 3.0, wo wir alle, alles mitschreiben können.
Nachtrag: Im Augenblick sind die Türchen mit altem Kram verlinkt. Immer das Selbe glaube ich. Ab Dezember dann gut befüllt und bei erreichen des Tages zu öffnen. Ist doch klar. Ich werde auch nicht verraten, was von wem kam. Oh, das ist ja dann auch mit Raten und so. Prima.
























nachdem die Morphine mich heute eiskalt weggedrückt hat, es im Scho Schonenland einsam und kalt ist, habe ich mir was gebastelt. Man muss sich ja beschäftigen. Mir bluten schon die Augen, aber es hat sich gelohnt.
Erst wollte ich ja alle Türchen selbst befüllen, aber wenn ich mir meinen Kalender so anschaue, wird das wohl nichts. Daher rufe ich hier jetze mal auf, mir 23 Geschichten oder Bilder zu schicken, nee, bitte nur die Links. Man sehe mir nach, das ich eitel bin und die 24 für mich behalte. Wie früher schon, wird die 24 zuerst aufgemacht. Also ich für mich. Habe da auch ne ziemlich starke Idee, wenn es umsetzbar ist. Klar ist es umsetzbar. Also Frau Bona her mit einem Bild. Bueffel, Schluessi, Kuhlumbus, Lunally, biochemiker, platzwart, Morphine, Zig, eric, bluete, aurorask, dezentral, diagonale, himbeer, eria, beetfreeq, gorilla und massuma alle wie ihr da seid und die, die das hier lesen und auch wollen: Bitte schön, es sind noch Nummern frei. Raus mit de Ideen. Sollte natürlich was mit Weihnachten zu tun haben.
Selbst wenn ich nicht da sein sollte, habe ich ja die Schluessel an Bueffel, Morphinchen und Zig abgegeben.
So. Nun bin ich mal gespannt ob wir das hinkriegen, das Bloggen 3.0, wo wir alle, alles mitschreiben können.
Nachtrag: Im Augenblick sind die Türchen mit altem Kram verlinkt. Immer das Selbe glaube ich. Ab Dezember dann gut befüllt und bei erreichen des Tages zu öffnen. Ist doch klar. Ich werde auch nicht verraten, was von wem kam. Oh, das ist ja dann auch mit Raten und so. Prima.

























... link (12 Kommentare) ... comment
Montag, 30. Oktober 2006
cabman, 21:08h
Hier und da ist Gruselzeit. Und weil nur Dichtungen dichten, reime ich mir was zusammen:

Oh , komm her und tanz mit mir,
wenn du magst die ganze Nacht.
Dann gehörst du mir allein,
es wird nie mehr besser sein.
Höre nicht was sie da mahnen,
glaube nicht was sie da reden,
was du willst das kann ich dir
heute Nacht schon geben.
6 und 6 und noch mal 6,
18mal sollst du dich drehen,
schließe deine Augen zu,
deine Wunschwelt wirst du sehen.
Bist du stark und traust du dich,
ergreifst du die gereichte Hand.
Zahle willig mir den Preis,
führe ich dich ins Wunderland.
Gib nur einmal ein Gelübde,
ein Gebot aus rotem Mund,
tue es laut und tue es jetzt,
tue es der ganzen Erde kund.
Alles, alles sollst du haben,
alles kannst du nehmen,
doch denke stets und immer dran,
einst musst du auch geben.
Dies Flackern da in meinen Augen
muss dich heut nicht kümmern,
morgen gehört dir diese Welt und
deine Sorgen sind in Trümmern.
Nun schwöre jetzt und schwöre hier,
du wirst immer mir gehören,
zweifle nicht, was hast du schon
in deinem Leben zu verlieren?
Greif endlich zu und nimm es dir,
was schon lange dein Begehr,
siehst du wohl es tut dir gut,
und ist auch gar nicht schwer.
Was du willst bin ich für dich,
such dir etwas aus,
und nur einmal warn ich dich,
aus dem Vertrag kommt keiner raus!

wenn du magst die ganze Nacht.
Dann gehörst du mir allein,
es wird nie mehr besser sein.
Höre nicht was sie da mahnen,
glaube nicht was sie da reden,
was du willst das kann ich dir
heute Nacht schon geben.
6 und 6 und noch mal 6,
18mal sollst du dich drehen,
schließe deine Augen zu,
deine Wunschwelt wirst du sehen.
Bist du stark und traust du dich,
ergreifst du die gereichte Hand.
Zahle willig mir den Preis,
führe ich dich ins Wunderland.
Gib nur einmal ein Gelübde,
ein Gebot aus rotem Mund,
tue es laut und tue es jetzt,
tue es der ganzen Erde kund.
Alles, alles sollst du haben,
alles kannst du nehmen,
doch denke stets und immer dran,
einst musst du auch geben.
Dies Flackern da in meinen Augen
muss dich heut nicht kümmern,
morgen gehört dir diese Welt und
deine Sorgen sind in Trümmern.
Nun schwöre jetzt und schwöre hier,
du wirst immer mir gehören,
zweifle nicht, was hast du schon
in deinem Leben zu verlieren?
Greif endlich zu und nimm es dir,
was schon lange dein Begehr,
siehst du wohl es tut dir gut,
und ist auch gar nicht schwer.
Was du willst bin ich für dich,
such dir etwas aus,
und nur einmal warn ich dich,
aus dem Vertrag kommt keiner raus!

... link (6 Kommentare) ... comment
Donnerstag, 19. Oktober 2006
Vom Wissen und seinen Preis
cabman, 12:46h
So. Das waren nun 4 Tage und die restlichen Stunden bis die Bahn geht Schweiz. Zürich, Bern, Basel und wieder Zürich. Von hier nehme ich mit: Ohrenschmerzen vom ewigen oderrr, eine aufkeimende Erkältung und ne halbe Flasche Vicks MediNait sowie ein recht interessantes Jobangebot, aber wer will schon in Bern wohnen? Dann ist mir aufgefallen, dass vom Jahreszeitenvoraushüpfen eine wichtige Zeit des Jahres von mir übersehen wurde: Halloween! Jawoll. Ich entschuldig mich dafür demütigst, bitte um gerechte Bestrafung und sende eine kleine Halloweengeschichte in die unendlichen Weiten des Netzes.
Diese ließe sich vortrefflich lesen, so wie damals in der Schule, einer ließt den Part des Raben, einer des Gelehrten und einer den Rest. Wie ich darauf komme? Keine Ahnung, wäre aber witzig und weil mein Account gleich ausläuft, poste ich das ganze jetze mal. Morgen dann Österreich, aber nur wenn die Bahn will.
 Die Erde liegt danieder, bedeckt vom weißen Totentuch. Flüsse und Seen vom Eiskönig geküsst, ruhen in regungsloser Starre, und Stille allerorten mein Atmen schreien lässt. Ich folge ihm mit sachtem Schritt durch tiefe Wehen und bitterkalter Nacht, erhellt nur durch flackerndes Licht der Petroleumlampe dort am Stab.
Die Erde liegt danieder, bedeckt vom weißen Totentuch. Flüsse und Seen vom Eiskönig geküsst, ruhen in regungsloser Starre, und Stille allerorten mein Atmen schreien lässt. Ich folge ihm mit sachtem Schritt durch tiefe Wehen und bitterkalter Nacht, erhellt nur durch flackerndes Licht der Petroleumlampe dort am Stab.
Ich folge dem Pfad, ausgetreten von so vielen, die denen, die den letzten Weg schon hinter sich hatten, Geleit gaben.
Am schmiedeeisernen Tore ich mich wieder fand, da, wo der Eintritt niemals Glück verheißt und dessen Durchschreiten von Trauer und Bitterkeit begleitet wird.
„Wie kannst du es wagen, die Ruhe der Toten zu so später Stunde zu stören?“ Sprach es aus der Dunkelheit mit krächzender Stimme, die Mark und Bein erschüttern ließ.
„Wer da, der mich pflegelhaft und feig aus dunkler Deckung zur Rede stellt.“ Antwortete ich mit fester Stimme, hoffend die Angst zu verbergen, die mich überfiel.
„Weil du es nicht siehst, ist es noch lange nicht versteckt und das, was du in deinem Herzen versteckt glaubtest, kann sehen ich. Du hast Angst, doch wovor? Bist du gekommen Unheil zu verrichten?“
„Zeig Dich erst, dann will ich dir vielleicht verraten, was im Schilde ich führe.“
„Zu sehen bin ich, wenn du willst. Hebe deinen Blick!“ Krächzte es.
Ich tat wie mir geheißen und da, plötzlich, ward ich gewahr, ein Rabe saß auf dem Pfosten da zur Rechten, der das Tor zur Hälfte in Angeln trug. Ein Rabe! Fuhr es mir in den Sinn, wie kann es sein, das reden er vermag? Mir grauste es und ich schüttelte den Kopf, dieses Trugbild meiner übernächtigen Fantasie abzuschütteln. Ein Trugbild musst es sein, für wahr!
„Schwer fällt es dir zu glaube, dass reden ich kann, nicht wahr?“ Spottet der Rabe von hochoben auf mich herab und stolzierte von links nach rechts. „Du glaubst eine Einbildung wäre ich, doch lass dir sagen, ich bin so wirklich wie du.“
„Aber wie kann es sein, das der Sprache der Menschen du mächtig bist?“ Fragte ich ungläubig doch ohne Angst.
„Ihr Menschen, “ rief er aus „wisst so vieles und so vieles wisst ihr nicht. Nie werdet ihr es erfahren, weil blind und taub ihr seid. Hättest bei Tag du mich getroffen, wenn Trubel und Gezedere eurer kleinen Welt mit ihren großen Sorgen taub dich machten, dann hättest wohl kaum du mich gehört. Hättest du?“
„Wissen tue ich es nicht.“
„Natürlich nicht. Du bist ein Mensch. Und nun sage mir, was führt zu nächtlicher Stunde dich hier raus zum Ruhehof der Toten?“
„Forscher bin ich und Gelehrter, die Erforschung des menschlichen Körpers bin gekommen ich.“
„Hier!“ Rief der Rabe voller Erstaunen.
„Hier, wo des Todes Lieben liegen? Wie mutig musst du sein, dass du es wagst, an seinem Eigentum dich zu vergehen?“
„Hah! Eigentum. Wir Menschen sind niemandes Eigentum!“
„Nicht mal Gottes? Nicht mal dessen, den ihr so verehrt?“
„Niemandes! Gott ist eine Erfindung! Ich glaube nicht an ihn!“
„Und was ist mit dem Teufel?“
„Angst vor dem Teufel ich nicht habe, daher einen Gott ich nicht brauche. Ich bin ein Mann der Wissenschaft!“
„Wohl an, du scheinst mir gerade der Rechte. Zeigen will ich etwas dir und nur dir und nur heute!“ Mit diesen Worten schwang der Rabe sich auf und in hohem Bogen er zu mir geflogen kam. Er landete auf meiner Schulter und flüsterte: „Das, wonach suchen du kamst, kann geben ich dir auch ohne Müh. Doch bist bereit du, mir auch etwas dafür zu geben?“
„Was solle dies sein? Ich bin arm, habe keinen Taler. Was also, so frage ich Dich, könntest du von mir bekommen?“
„Nichts was dich ärmer macht, doch wissen wirst du, wenn ich es holen tat. Willst sehen du nun, wie ihr Menschen funktioniert, willst mit Wissen deinen Kopfe füllen?“
„So sei es, denn wenn es mich nicht ärmer macht, kann es mich nichts kosten. Zeige mir nun wie die Dinge sind, die wir nicht sehen, doch spüren.“
„Abgemacht.“ Rief der Rabe und vor mir, aus dem Nichts, erschien der Körper eines Mannes. Er war nackt mit grauer Haut. Doch als ich ihn berührte, verschwand diese und ich sah die Muskelnfasern und allerlei Gewebe. Als ich es wieder tat, konnte die Adern ich sehen, es war wunderschön. Ich schrieb alles in mein Tagebuch, die Dinge die ich sah, zeichnete sie, die ganze Nacht hindurch wie im Fieber, wie im Rausch, ich konnte nicht anders, denn Neugier hatte mich gepackt. Es war so einfach, ich gebrauchte nicht mein Skalpell und als der Morgen im Osten ergraute, sprach der Rabe: „Ist dein Wissensdurst nun gestillt? Sahest du, was zu sehen du kamst?“
„Oh, es war mehr als zu erhoffen ich wagte. Mein Dank gilt dir, denn du hast mich zu einem Gelehrten gemacht. Nun weiß ich alles und vieles wurde klar“
„Nichts weißt du! Nichts von dem was es zu wissen gilt.“
„Ich weiß nun wie und warum wir leben.“
„Oh nein, das weißt du nicht und wirst es nie! Ich werde dich nun verlassen, Mann der Wissenschaft. Wir werden uns nicht wieder sehen, drum sag Adieu ich dir und gedenk meiner.“
„Das werde ich, Adieu!“ So flog er davon und ich habe ihn seit dem nicht wieder gesehen, wohl aber seiner gedacht, denn als nach Hause ich kam, glücklich dessen was mir widerfuhr, so freudig, die Nachricht gleich meinem lieben Weibe zu künden, da fand ich sie jung und schön und tot im Ehebette. Ich wusste, der Rabe hatte sie geholt, mein liebes Weib und wie unwahr hatte ich gesprochen, denn wenn es mich auch nicht ärmer machte, so kostete es mich doch die Liebe ihrer, was mehr kann man verlieren, welch höheren Preis hätte zahlen ich können?
Diese ließe sich vortrefflich lesen, so wie damals in der Schule, einer ließt den Part des Raben, einer des Gelehrten und einer den Rest. Wie ich darauf komme? Keine Ahnung, wäre aber witzig und weil mein Account gleich ausläuft, poste ich das ganze jetze mal. Morgen dann Österreich, aber nur wenn die Bahn will.
 Die Erde liegt danieder, bedeckt vom weißen Totentuch. Flüsse und Seen vom Eiskönig geküsst, ruhen in regungsloser Starre, und Stille allerorten mein Atmen schreien lässt. Ich folge ihm mit sachtem Schritt durch tiefe Wehen und bitterkalter Nacht, erhellt nur durch flackerndes Licht der Petroleumlampe dort am Stab.
Die Erde liegt danieder, bedeckt vom weißen Totentuch. Flüsse und Seen vom Eiskönig geküsst, ruhen in regungsloser Starre, und Stille allerorten mein Atmen schreien lässt. Ich folge ihm mit sachtem Schritt durch tiefe Wehen und bitterkalter Nacht, erhellt nur durch flackerndes Licht der Petroleumlampe dort am Stab. Ich folge dem Pfad, ausgetreten von so vielen, die denen, die den letzten Weg schon hinter sich hatten, Geleit gaben.
Am schmiedeeisernen Tore ich mich wieder fand, da, wo der Eintritt niemals Glück verheißt und dessen Durchschreiten von Trauer und Bitterkeit begleitet wird.
„Wie kannst du es wagen, die Ruhe der Toten zu so später Stunde zu stören?“ Sprach es aus der Dunkelheit mit krächzender Stimme, die Mark und Bein erschüttern ließ.
„Wer da, der mich pflegelhaft und feig aus dunkler Deckung zur Rede stellt.“ Antwortete ich mit fester Stimme, hoffend die Angst zu verbergen, die mich überfiel.
„Weil du es nicht siehst, ist es noch lange nicht versteckt und das, was du in deinem Herzen versteckt glaubtest, kann sehen ich. Du hast Angst, doch wovor? Bist du gekommen Unheil zu verrichten?“
„Zeig Dich erst, dann will ich dir vielleicht verraten, was im Schilde ich führe.“
„Zu sehen bin ich, wenn du willst. Hebe deinen Blick!“ Krächzte es.
Ich tat wie mir geheißen und da, plötzlich, ward ich gewahr, ein Rabe saß auf dem Pfosten da zur Rechten, der das Tor zur Hälfte in Angeln trug. Ein Rabe! Fuhr es mir in den Sinn, wie kann es sein, das reden er vermag? Mir grauste es und ich schüttelte den Kopf, dieses Trugbild meiner übernächtigen Fantasie abzuschütteln. Ein Trugbild musst es sein, für wahr!
„Schwer fällt es dir zu glaube, dass reden ich kann, nicht wahr?“ Spottet der Rabe von hochoben auf mich herab und stolzierte von links nach rechts. „Du glaubst eine Einbildung wäre ich, doch lass dir sagen, ich bin so wirklich wie du.“
„Aber wie kann es sein, das der Sprache der Menschen du mächtig bist?“ Fragte ich ungläubig doch ohne Angst.
„Ihr Menschen, “ rief er aus „wisst so vieles und so vieles wisst ihr nicht. Nie werdet ihr es erfahren, weil blind und taub ihr seid. Hättest bei Tag du mich getroffen, wenn Trubel und Gezedere eurer kleinen Welt mit ihren großen Sorgen taub dich machten, dann hättest wohl kaum du mich gehört. Hättest du?“
„Wissen tue ich es nicht.“
„Natürlich nicht. Du bist ein Mensch. Und nun sage mir, was führt zu nächtlicher Stunde dich hier raus zum Ruhehof der Toten?“
„Forscher bin ich und Gelehrter, die Erforschung des menschlichen Körpers bin gekommen ich.“
„Hier!“ Rief der Rabe voller Erstaunen.
„Hier, wo des Todes Lieben liegen? Wie mutig musst du sein, dass du es wagst, an seinem Eigentum dich zu vergehen?“
„Hah! Eigentum. Wir Menschen sind niemandes Eigentum!“
„Nicht mal Gottes? Nicht mal dessen, den ihr so verehrt?“
„Niemandes! Gott ist eine Erfindung! Ich glaube nicht an ihn!“
„Und was ist mit dem Teufel?“
„Angst vor dem Teufel ich nicht habe, daher einen Gott ich nicht brauche. Ich bin ein Mann der Wissenschaft!“
„Wohl an, du scheinst mir gerade der Rechte. Zeigen will ich etwas dir und nur dir und nur heute!“ Mit diesen Worten schwang der Rabe sich auf und in hohem Bogen er zu mir geflogen kam. Er landete auf meiner Schulter und flüsterte: „Das, wonach suchen du kamst, kann geben ich dir auch ohne Müh. Doch bist bereit du, mir auch etwas dafür zu geben?“
„Was solle dies sein? Ich bin arm, habe keinen Taler. Was also, so frage ich Dich, könntest du von mir bekommen?“
„Nichts was dich ärmer macht, doch wissen wirst du, wenn ich es holen tat. Willst sehen du nun, wie ihr Menschen funktioniert, willst mit Wissen deinen Kopfe füllen?“
„So sei es, denn wenn es mich nicht ärmer macht, kann es mich nichts kosten. Zeige mir nun wie die Dinge sind, die wir nicht sehen, doch spüren.“
„Abgemacht.“ Rief der Rabe und vor mir, aus dem Nichts, erschien der Körper eines Mannes. Er war nackt mit grauer Haut. Doch als ich ihn berührte, verschwand diese und ich sah die Muskelnfasern und allerlei Gewebe. Als ich es wieder tat, konnte die Adern ich sehen, es war wunderschön. Ich schrieb alles in mein Tagebuch, die Dinge die ich sah, zeichnete sie, die ganze Nacht hindurch wie im Fieber, wie im Rausch, ich konnte nicht anders, denn Neugier hatte mich gepackt. Es war so einfach, ich gebrauchte nicht mein Skalpell und als der Morgen im Osten ergraute, sprach der Rabe: „Ist dein Wissensdurst nun gestillt? Sahest du, was zu sehen du kamst?“
„Oh, es war mehr als zu erhoffen ich wagte. Mein Dank gilt dir, denn du hast mich zu einem Gelehrten gemacht. Nun weiß ich alles und vieles wurde klar“
„Nichts weißt du! Nichts von dem was es zu wissen gilt.“
„Ich weiß nun wie und warum wir leben.“
„Oh nein, das weißt du nicht und wirst es nie! Ich werde dich nun verlassen, Mann der Wissenschaft. Wir werden uns nicht wieder sehen, drum sag Adieu ich dir und gedenk meiner.“
„Das werde ich, Adieu!“ So flog er davon und ich habe ihn seit dem nicht wieder gesehen, wohl aber seiner gedacht, denn als nach Hause ich kam, glücklich dessen was mir widerfuhr, so freudig, die Nachricht gleich meinem lieben Weibe zu künden, da fand ich sie jung und schön und tot im Ehebette. Ich wusste, der Rabe hatte sie geholt, mein liebes Weib und wie unwahr hatte ich gesprochen, denn wenn es mich auch nicht ärmer machte, so kostete es mich doch die Liebe ihrer, was mehr kann man verlieren, welch höheren Preis hätte zahlen ich können?

... link (2 Kommentare) ... comment
... nächste Seite




